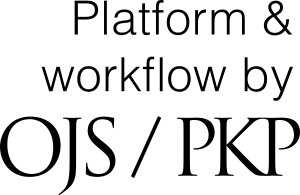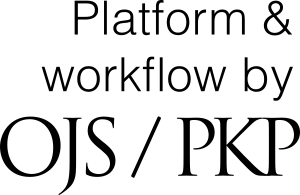Zum Gebrauch von Kategorien in studentischen Äußerungen über Inklusion. Ein empirischer Beitrag zur Differenzforschung
On the use of categories in student utterances about inclusion. An empirical contribution to difference research
DOI:
https://doi.org/10.21248/qfi.71Schlagworte/Keywords
Differenzforschung, Diskursanalyse, Interviewforschung, Lehrer*innenbildung, De-/Kategorisierung, Difference Research, Discourse Analysis, Interview Research, Teacher Education, De-/CategorisationsZusammenfassung
Kategorisierungen spielen im Schulalltag eine Rolle, der Einsatz und Gebrauch von Kategorien werden in der De-/Kategorisierungsdiskussion schon länger in Beztug auf ihre Effekte reflektiert. In der vorliegenden Studie wird auf Grundlage eines differenzierungstheoretischen Kategorienverständnisses gefragt, wie in studentischen Äußerungen nach einem Praktikum in als inklusiv bezeichneten Schulklassen welche Kategorien oder kategorialen - z. T. auch eigenwilligen - Bezeichnungen aktualisiert bzw. hervorgebracht werden und welche diskutsive Funktion dieser Kategoriengebrauch übernimmt. Auf Grundlage diskursanalytisch ausgewerteter Interviews werden im Ergebnis drei Figuren herausgearbeitet, die Schwierigkeiten in den Zuordnungen von Schüler*innen von Schüler*innen zu kategorialen Bezeichnungen zeigen. Indem von der Lehrkraft zur Verfügung gestelltes Wissen und eigene Beobachtungen geschildert werden, wird versucht, diese Schwierigkeit durch die Herstellung Eindeutigkeiten in Zuordnungen zu bearbeiten. Die Ergebnisse werden schließlich produktiv für Anschlüsse zur Thematisierung unterrichtlicher und schulischer Kategorisierungen und Differenzierungen in der Lehrer*innenbildung gewendet.
Abstract
Categorisations play a role in everyday school life. But also the deployment and use of categories have long been reflected in the discussion on (de-)categorisation with regard to their effects. In the present study, on the basis of a difference-theoretical understanding of categories, it is asked in student utterances, how which categories or categorical – partly idiosyncratic – designations are produced after an internship in school classes designated as inclusive. Another focus was also what discursive function this use of categories assumes. On the basis of discourse-analytically evaluated interviews, three discursive figures are elaborated in the results, which show difficulties in the assignments of pupils to categorical designations. By describing the knowledge provided by the teacher and the teacher's own observations, an attempt is made to work on these difficulties by creating unambiguities in classifications. Finally, the results are used productively for connections to the thematization of classroom and school categorisations and differentiations in teacher education.
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2022 Marian Laubner

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International.