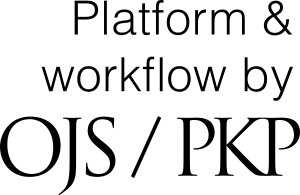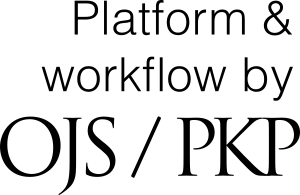Corona - eine Krise für die Kooperation?
Corona – a crisis for cooperation?
DOI:
https://doi.org/10.21248/qfi.58Schlagworte/Keywords
Kooperation, Corona, Resonanz, Individualisierung, Entwicklung, cooperation, resonance, individualisation, developmentZusammenfassung
Der Artikel greift vor dem Hintergrund der Theorieperspektive der Synthetischen Humanwissenschaften auf, wie sich Kooperationsbeziehungen von Schüler*innen und Lehrpersonen in ihrer Intensität wie Funktionalität durch die pandemiebedingt plötzlich und signifikant auftretenden Änderungen des Alltags der Institution Schule verändern. Dies wird hinsichtlich der Auswirkungen auf individuelle Entwicklung und Entwicklungspotentiale von Schüler*innen gespiegelt, um daran anknüpfend Ableitungen für Bildungsprozesse zu ziehen. Einzelne Ausschnitte aus explorativ geführten Interviews erweitern den theoretischen Bezugsrahmen durch Aussagen von Praktiker*innen hinsichtlich einer schulischen und professionstheoretischen Perspektive.
Abstract
The article discuses theoretically how cooperation among students and teachers changed in its intensity and functionality for learning during the significant changes of the institution school due to the Corona-pandemic restrictions. Those changes are to be analysed in their influence on individual development and potentials. Selected explorative interviews with teachers and parents about their perception on the crisis and its caused changes may add a practical perspective from school to the pedagogical theory.
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2021 Anke Langner, Clemens Milker

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International.