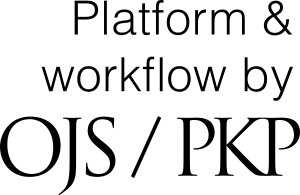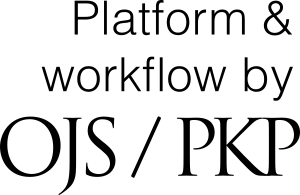Inklusion ist (k)eine Frage der Persönlichkeit - Inklusive Kompetenzen institutionell verankern!
Inclusion as a question of personality? Embedding resources for inclusive education in teacher training and postsecondary institutional structures
DOI:
https://doi.org/10.21248/qfi.23Schlagworte/Keywords
Inklusive Hochschule, Hochschulentwicklung, Partizipative Lehre, Bildungsfachkräfte, Behinderungserfahrung, Inklusion, Inclusive education, postsecondary education, social justice pedagogy, teacher training, disability studies, participatory educationZusammenfassung
Orientiert am Themenschwerpunkt der „theoretischen und empirischen Klärung des Verständnisses pädagogischer Fachlichkeit“ beschäftigt sich unser Beitrag mit den Barrieren und Chancen, die sich in der Hochschulstruktur und –kultur und der universitären Lehre darstellen, wobei wir uns exemplarisch der Ausbildung inklusionsbezogener pädagogischer Fachlichkeit bei angehenden Lehrkräften zuwenden. Mit Bezug zu aktuellen Entwicklungen der bildungspolitischen Landschaft in Deutschland wird zunächst die Notwendigkeit eines Umdenkens in der Lehramtsausbildung, wie auch in der gesamten Hochschullandschaft, dargelegt und diskutiert. Dabei wird das dem Beitrag zugrunde liegende Verständnis von Inklusion verdeutlicht. Die sich daraus ergebenden Anforderungen an Hochschulen, besonders in Bezug auf ihr Selbstverständnis, das Verständnis von Wissenschaftlichkeit und die gelebte Hochschulkultur, werden daraufhin formuliert. Daran schließen Überlegungen zur Umsetzung inklusionsorientierter Praxen in der Lehrer*innenbildung an. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der partizipativen Lehre als möglichem Werkzeug für eine inklusionssensible Hochschulentwicklung. Am Beispiel partizipativer Lehre gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten1 werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Menschen, die bisher keinen Zugang zur akademischen Wissensvermittlung hatten, als Lehrende tätig sein und so sowohl von Biografien unter der Erfahrung von Diskriminierung berichten, als auch diese Erfahrungen in die Produktion von Wissen einfließen lassen können. In der Diskussion um partizipative Lehre werden verschiedene Widersprüche und Diskurse deutlich, die geeignet sind, um über Hochschulkulturen und -praxen neu nachzudenken.
Abstract
The following article examines the consequences that current discussions about inclusive education have for post-secondary education, especially regarding teacher training. Teachers in the various types of schools in Germany are expected to be able to accommodate the needs of different pupils, while their training is not equipping them sufficiently for it. They are learning about inclusive education in a highly exclusive educational setting. Therefore, the structure of post-secondary education that is setting out to train professionals able and willing to implement inclusive values has to change. We will first discuss current developments at universities that are contradictory to inclusive efforts, then spell out the requirements that teacher training for inclusion poses to the universities and point out some strategies that can further the development towards more inclusive practices and skill development for teachers in training. A strong emphasis is therein placed on participatory teaching, meaning that people usually excluded from tertiary education participate in teaching at universities. This will be examined through recent efforts to include people with learning difficulties at universities. The administrative, social and financial struggles accompanying these efforts are in themselves helpful in identifying risks for exclusion and are by far outweighed by the advantages for the development of an inclusive setting in post-secondary education.