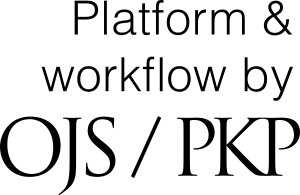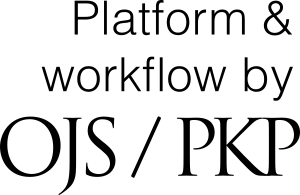Wir führen eine anonymisierte Nutzungsstatistik. Bitte lesen Sie die Datenschutz-Informationen, um mehr zu erfahren.
Aktuelle Ausgabe
Liebe Leser*innen,
herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der QfI – Qualifizierung für Inklusion! In dieser Ausgabe erwarten Sie fünf Beiträge, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit Fragen der Lehrer*innenbildung, professioneller Kooperation und innovativer Methoden auseinandersetzen. Gemeinsam werfen sie ein Schlaglicht darauf, wie komplex, widersprüchlich, aber auch zukunftsweisend die Diskussion um Qualifizierung für Inklusion derzeit geführt wird.
Oldenburg und Laubner nehmen in ihrem Beitrag "Die Vielstimmigkeit von Inklusion: Empirische Analysen von Interaktionen zwischen Studierenden und Lehrkräften in Gastvorträgen der universitären Lehrer:innenbildung" Bezug auf die Frage, wie Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden gestaltet ist. Sie zeigen, dass Interaktionen nicht nur formale Abläufe darstellen, sondern entscheidend für die Entfaltung von Teilhabe und Vielstimmigkeit im Hochschulkontext sind.
In ihrem Beitrag „Die Kooperation zwischen Regel- und sonderpädagogischen Lehrpersonen in der Praxis verstehen - Ein multimethodischer Blick auf Kooperation im Kontext schulischer Inklusion “ befassen sich Nicole Reinsdorf und Antje Ehlert mit den Bedingungen und Herausforderungen professioneller Zusammenarbeit. Sie machen deutlich, dass Kooperation zwar als Grundpfeiler inklusiver Praxis gilt, aber in der Realität durch strukturelle Ungleichheiten und mangelnde Ressourcen erschwert wird.
Malte Delere nimmt in seinem Beitrag ""Bevor ich das Universal Design for Learning kennengelernt habe, konnte ich mir nur begrenzt vorstellen, meinen zukünftigen Unterricht inklusive zu gestalten." Analyse reflexiver Memos von Lehramtsstudierenden" Bezug zur Bedeutung von Theorien in der Ausbildung. Er verdeutlicht, wie die Auseinandersetzung mit UDL das Denken von Studierenden in Bewegung bringt – weg von defizitorientierten Sichtweisen hin zu einer Öffnung für Vielfalt.
Der Beitrag „Inklusiv-digitale Bildung im Studium zur Lehrkraft für Berufskunde im Hauptberuf: Analyse eines Interventionsprogramms" befasst sich thematisch mit der Rolle digitaler Lernumgebungen im schweizer Bildungssystem. Darin zeigt René Wüthrich, dass digitale Formate Potenziale zur Förderung von Inklusionskompetenzen bergen, gleichzeitig aber kritisch hinterfragt werden müssen, da sie selbst nie neutral sind, sondern Bildungsprozesse spezifisch strukturieren.
Lebzelter und Lebzelter thematisieren in ihrem Beitrag „Planspiel Inklusion 2.0“ schließlich die Möglichkeiten spielerischer Formate. Sie eröffnen neue Zugänge zur Auseinandersetzung mit Inklusion, verweisen aber zugleich auf die Notwendigkeit, solche Methoden kritisch zu prüfen: Welche Vorstellungen von Inklusion werden dadurch gestützt – und wo droht Vereinfachung komplexer Wirklichkeiten?
In ihrer Gesamtheit macht die Ausgabe deutlich, dass Qualifizierung für Inklusion nicht allein eine Frage der richtigen Methoden oder Modelle ist. Vielmehr geht es um die Aushandlung professioneller Haltungen, die Reflexion institutioneller Strukturen und den Mut, auch Widersprüche sichtbar zu machen. Kooperation, Interaktion und innovative Ansätze erscheinen als Schlüsselthemen – doch ihre Umsetzung hängt wesentlich von den Rahmenbedingungen ab, die Bildungssysteme zur Verfügung stellen.
Wir laden Sie herzlich ein, sich mit den Beiträgen auseinanderzusetzen, sich inspirieren zu lassen und zugleich kritisch zu prüfen, welche Impulse für Forschung, Lehre und Praxis aufgegriffen werden können.
Viel Freude beim Lesen und gewinnbringende Anregungen wünscht Ihnen
im Namen der Redaktion
Sophia Laux
Artikel

Diese Zeitschrift ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.